Eigentlich will der Maler Basil den Namen seines neuen Freundes gar nicht nennen, schon gar nicht dem betont amoralischen Lord Henry gegenüber. Dann rutscht er ihm doch heraus: „Natürlich bin ich nicht wie Dorian Gray“, sagt er. Das ist zunächst auf das Aussehen gemünzt – Henry hatte nach dem Modell des neuesten Bildes gefragt, das er im Atelier des Malers gesehen hatte, und ungläubig auf dessen Äußerung reagiert, in dem Bild stecke „zu viel von mir drin“.
Wenn es aber nicht das Erscheinungsbild ist, das Basil mit dem, wie Henry ihn nennt, „jungen Adonis“ verbindet, was haben die beiden – der Maler und das Bild – dann gemeinsam? Und welche Rolle spielt dabei Henry, beider Beobachter?
Daraus sind die süßen Träume gemacht
Die Frage nach dem Verbindenden und Trennenden der drei Figuren durchzieht die Bühnenfassung von Oscar Wildes „Das Bildnis des Dorian Gray – publiziert 1890 als Erzählung und 1891 wesentlich erweitert als Roman –, die der Regisseur Ran Chai Bar-zvi gemeinsam mit Lukas Schmelmer erstellte und nun in den Kammerspielen des Schauspiel Frankfurt auf die karge Bühne brachte. Anfangs sind die Rollen klar verteilt: Basil, gespielt von Miguel Klein Medina, geht es um seine Kunst und um sein Modell, in das er offensichtlich verliebt ist. Stefan Grafs zynischer Lord Henry, auch er fühlt sich von dem schönen Dorian angezogen, haut ein Bonmot nach dem anderen heraus und wirkt heftig daran mit, die bezaubernde Naivität des jungen Mannes mit der Wirklichkeit zu konfrontieren, was letztlich darauf hinausläuft, ihn zu seinesgleichen zu machen.
 Miguel Klein Medina, Stefan Graf, Mitja Over (v. l.)Robert Schittko
Miguel Klein Medina, Stefan Graf, Mitja Over (v. l.)Robert SchittkoUnd Dorian? Der Schauspieler Mitja Over muss in der gedrängten Zeit von nicht einmal neunzig Minuten, in die der Roman hier gepresst wird, die Wandlung vom Unschuldslamm zum abgebrühten Dandy und Mörder durchmachen, vom gefeierten Gesellschaftsdebütanten zum gemiedenen Wüstling. Der Weg dahin führt über eine sehr schön choreographierte Tanzszene zu dritt zur Musik von „Sweet Dreams are made of this“, die Anpassung an den schrillen Bekleidungsstil der beiden älteren Männer, die ihn oft auf der ohnehin engen, durch eine drehbare Wand in der Mitte noch engere Bühne in die Zange nehmen, und schließlich über die Erfahrung von einer mittelbaren Schuld am Tod eines anderen Menschen, verbunden mit der Notwendigkeit, damit irgendwie umzugehen.
Der Ausweg ist bekannt: Dorian delegiert die Spuren seines wüsten Lebens, der Exzesse, der Schuld, an das von Basil gemalte Bild, das er vor der Welt verschließt. Ihm selbst also sieht man nichts an, auch nicht die zwanzig Jahre, die in der Romanhandlung vergehen. Der eigentliche Sprengstoff in diesem Konzept, den sowohl der Roman wie auch die kluge Bühnenfassung in den Blick nehmen, ist die Frage, ob das, was man nicht sieht, nicht trotzdem da ist, ob also der Kinderglaube an die Macht des Augenzukneifens im Fall des an der Schwelle zum Erwachsenenseins stehenden Dorian tatsächlich etwas bewirkt.
Alles bleibt in der Schwebe
Die Szene, die diese Entwicklung einleitet und auf den Punkt bringt, gehört zu den stärksten des Abends. Dorian hat Basil und Henry in ein schäbiges Eastend-Theater mitgenommen, wo das Mädchen auf der Bühne steht, in das er sich verliebt hat und das er heiraten will. Nun starren sie auf die Bühne im Stück, also in die Richtung der Frankfurter Zuschauer, die wiederum einzig in den Gesichtern der drei einen Abglanz davon erhaschen, wie Dorians Freundin spielt. Das tut sie offensichtlich katastrophal, wie sich rasch in den anfangs vorfreudigen, dann mutig um Begeisterung ringenden und schließlich resignierten Mienen der drei ganz exzellent abzeichnet. Dorian nimmt seiner Verlobten das Versagen übel und lässt es sie spüren. Als er am nächsten Tag die Nachricht von ihrem Selbstmord erhält, versucht er zu weinen. Und kann es nicht.
Er sei eifersüchtig auf sein Bild, sagt Dorian einmal, und wieder sehen wir Zuschauer es nicht, weil der auf das Gemälde gerichtete Blick der Schauspieler von der Bühne zu uns geht. Alles bleibt in der Schwebe, vor allem das Verhältnis zwischen Modell und Abbild, das schließlich ein Epilog von Marcus Peter Tesch weiter auszuleuchten versucht.
Das eigentliche Stück geht zu Ende, ohne das Romanfinale mit der Rückverwandlung Dorians und seinem Tod zu zitieren. Danach stehen die drei Schauspieler am Bühnenrand, hinter ihnen der geschlossene rote Vorhang, die Rollen haben sie abgelegt und spielen sich die Bälle zu. Von Dorian und seinem Bild sprechen sie, davon, wie das Bild körperlich in sein Modell eindringt und Dorian den gealterten Körper des anderen liebevoll beschreibt, gerade im Verlust seiner Jugendlichkeit: „Ich liebe deinen traurigen Rest“.
Am Ende steht Dorian, versunken in gelassener Selbstliebe, vor dem Spiegel, besieht die Fältchen in den Mundwinkeln und macht seinen Frieden. Von seiner Vorlage entfernt sich das Stück mit dieser Wendung, die unverkennbar unserer narzisstischen Gegenwart geschuldet ist, erheblich, indem es den im Roman beschriebenen Narzissmus auf die Spitze treibt. Dass dabei von Schuld so gar keine Rede mehr ist, ist unheimlicher als alles andere.

 vor 3 Stunden
1
vor 3 Stunden
1



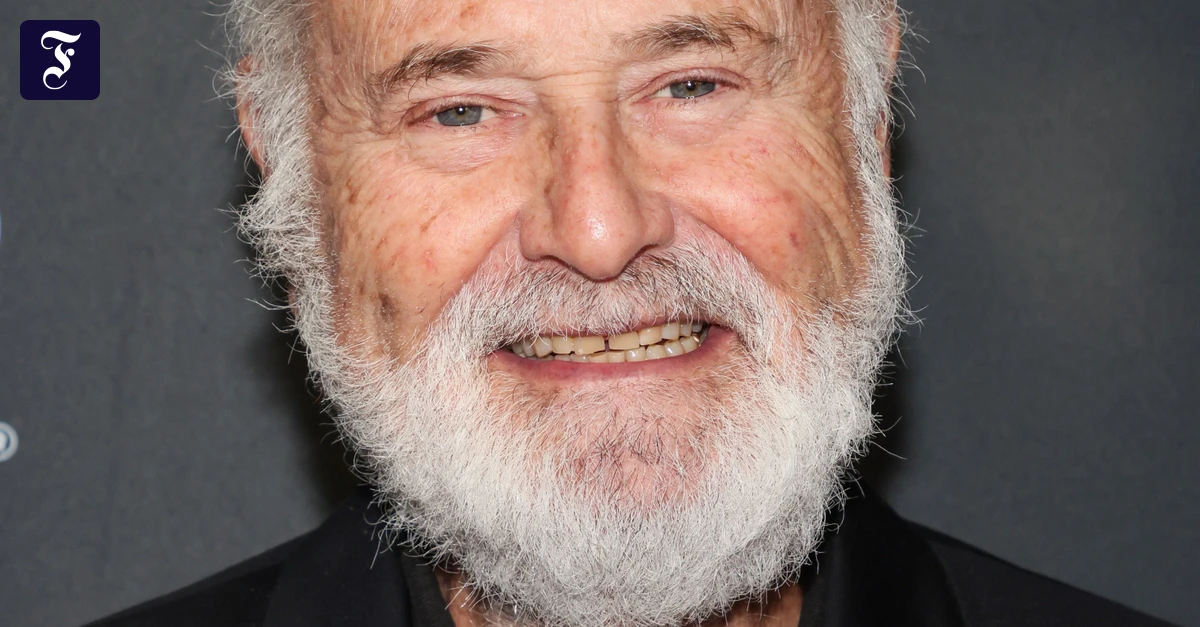



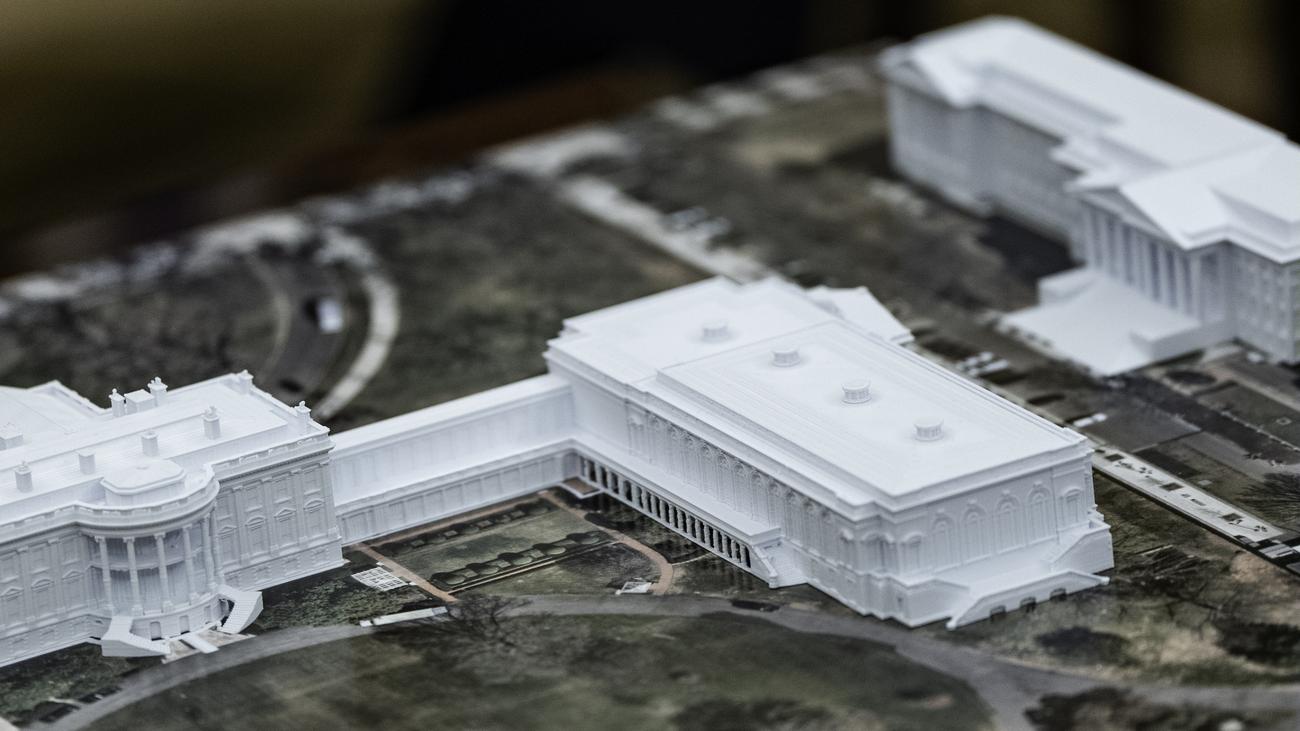


 English (US) ·
English (US) ·