Der Konzertsaal im Casals Forum der Kronberg Academy hat sich in kürzester Zeit den Ruf als einer der besten Kammermusiksäle der Welt erworben. Da er über ein eigenes modernes Tonstudio verfügt, kommen vermehrt Musiker hierher, um CD-Aufnahmen zu machen. Auch der Pianist Martin Helmchen hat für das Label Alpha Classics (Outhere) in diesem Saal eine Gesamtaufnahme aller Klaviersonaten von Franz Schubert begonnen. Die erste Doppel-CD ist bereits auf dem Markt. Wir stören ihn mitten in der Aufnahme der G-Dur-Sonate (er spielt ohne Schuhe, weil die beim Pedaltreten gerade knarren), um mit ihm über das Großprojekt zu reden.
Rudolf Steiner hat die Musik Franz Schuberts einmal als „sublimierte Rauflust“ bezeichnet. Wohin tendieren Sie, wenn Sie sich mit Schubert beschäftigen – zur Sublimation oder zur Rauflust?
Ach, das ist ja interessant! „Rauflust“ höre ich zum ersten Mal im Zusammenhang mit Schubert. Wir haben gerade im Finale der G-Dur-Sonate ein paar rustikal polternde Stellen aufgenommen. Das ist ein sehr volksmusikalischer Satz. Dazu würde das ganz gut passen. Im Hintergrund dieser Klarinetten-Polka, dieser dörflichen Idylle, ist wirklich eine Rauferei im Gange. Ansonsten glaube ich, dass Schubert mehr sublimiert, was alles unerfüllt im Leben blieb, und sich weniger rauft.
Aber gibt es nicht bei Schubert so häufig unmotivierte Ausbrüche von Gewalt? Sei es harmonisch, durch Lautstärke oder durch Satztechnik.
Absolut. Aber da zeigt sich so viel Zerrissenheit, Psychotisches, Abgründiges, dass mir „Rauflust“ dafür zu lebensfroh klingt. Diese Ausbrüche bei Schubert haben etwas Vulkanisches. Man spürt die ganze Zeit, während man auf der blühenden Wiese läuft, dass darunter die Lava brodelt. Auf einmal kommt sie plötzlich heraus. Gerade dann, wenn man es am wenigsten erwartet, mit einer Gewalt, die einem den Atem verschlägt.

Schubert hat etwas von einem Amokläufer: das Pummelchen am Klavier, von Freunden „Schwammerl“ genannt, das jede Menge Wut in sich hineinfrisst.
Sie haben völlig recht. Und diese Wut bricht aus ihm heraus ohne jegliche Hoffnung, dass sich durch den Ausbruch etwas ändern würde. Anders als bei Beethoven, der Wut nutzt, um etwas zu konstruieren und sich am Ende daraus zu erlösen. Bei Schubert ist immer klar: Das Schicksal, die Ungerechtigkeit, die stete Ferne des Glücks lassen sich niemals ändern. Seine Wutausbrüche haben nichts Befreiendes im Sinne von Veränderung oder Erlösung. Diese Wutausbrüche geschehen mit einem. Man wird von ihnen hilflos mitgerissen. Das packt einen als Hörer wie als Spieler existenziell.
Beethovens Wut ist immer in einen logischen Prozess integriert, der ein Ziel hat. Bei Schubert nicht.
Genau. Ich empfinde Schuberts Wut im Vergleich zu der Beethovens auch als irrational. Das berühmteste Beispiel ist der langsame Satz in fis-Moll aus der großen A-Dur-Sonate D 959, wo er so vehement dreinschlägt, dass nichts mehr übrig bleibt an Form, Harmonik, Zusammenhang. Da wird ein Grad an Chaos erreicht, der im 19. Jahrhundert nicht mehr überboten werden konnte. Da steht jemand im Auge des Sturms und kann nichts machen. Das ist die Erfahrung, größten Seelengewalten wehrlos ausgeliefert zu sein. Man ist – auch als Spieler – jedes Mal froh, wenn man wieder festen Boden unter den Füßen hat. Und die Beruhigung ist hinterher oft noch schmerzlicher als die Katastrophe selbst. Weil man da erst merkt: Das Schlimme war immer schon da, und das wird nicht weggehen. Nie!
 Martin HelmchenPeterrigaud
Martin HelmchenPeterrigaudFriedrich Gulda hat Schubert weitgehend gemieden, weil er sich nicht in einen Todesstrudel hinreißen lassen wollte. Ist das nicht übertrieben? Schubert fragte doch noch wenige Tage vor seinem Tod trotzig, ob es für ihn nicht einen Platz über der Erde gebe.
Bei Gulda, den ich sehr bewundere, war gewiss auch ein wenig Koketterie dabei. Ich kann seine Scheu trotzdem nachvollziehen. Wenn man wenigstens etwas Empathie mitbringt, spürt man den Menschen hinter der Musik bei Schubert unmittelbarer als bei vielen anderen Komponisten. Da entsteht eine Nähe, die einem an die Gurgel springt. Mir ging es bei der Aufnahme der mittleren a-Moll-Sonate auch so, dass ich nach dem ersten Take unterbrechen musste, weil ich so mitgenommen war. Es ist schwer, da als Interpret eine Distanz zu wahren.
Sie nehmen Schuberts Sonaten auf einem Bösendorfer-Flügel auf. Was sind die Gründe dafür?
Ich habe mich in dieses Instrument in diesem Saal in Kronberg verliebt. Man hat ja schon oft bemerkt, dass Schubert und Bösendorfer gut zusammenpassen. Der lyrische Charakter des Instruments fügt sich zum Grundton, indem die meisten Sätze Schuberts anheben, ganz hervorragend. Wenn dann die Ausbrüche kommen, die Extreme im Pianissimo wie im Fortissimo, hat man im ganz Lauten die Möglichkeit, es mit allen farbkräftigen Nebengeräuschen krachen zu lassen wie auf einem historischen Instrument, ohne dabei stilwidrig zu übersteuern. Bei einem Steinway hätte man an solchen Stellen ein viel zu großes Gesamtvolumen erreicht. Und auch im äußersten Pianissimo, das bei Schubert seitenweise anhalten kann, behält man auf einem Bösendorfer eine bessere Klangkontrolle. Man kann gefühlt fünfzehn Schattierungen eines Pianissimos bei gleichem Material machen, wo man bei anderen Instrumenten das Gefühl hätte, dauernd auf rohen Eiern zu laufen, aus Angst, dass es zu laut würde.
Da hilft ja meistens das linke Pedal.
Ja, aber das linke Pedal auf diesem Instrument macht den Klang nicht einfach nur leiser, sondern ist wie ein eigenes Register auf einem historischen Instrument. Es dämpft nicht nur, es färbt auch. Auch mechanisch hat dieser Flügel hervorragende Eigenheiten. Im vierten Satz der G-Dur-Sonate gibt es Pianissimo-Repetitionen, die wie für Streichsextett gesetzt sind. Wenn man das gleichmäßig und federnd und tänzerisch und noch melodisch zugleich spielen will, kommt man bei den meisten Instrumenten an die Grenzen der Mechanik. Hier geht es. Diese Kombination aus Saal und Instrument ist einfach beglückend.

Sie denken also in der Klangvorstellung über das Klavier hinaus. Im Siciliano der unvollendeten E-Dur-Sonate D 157 höre ich an einer Stelle bei Ihnen Holzbläserakkorde zum gezupften Kontrabass. Diese Bass-Pizzikati sind von Schubert allerdings in Oktaven gesetzt, was die geforderte leise und leichte Ausführung schwer macht.
Ja, das ist besonders schwer. Und gerade das geht hier besonders gut. Dieser Bösendorfer hat eine Charakteristik, die an historische Instrumente erinnert. Die Register heben sich stark voneinander ab und vermengen sich nicht zu einer Wolke. Bei Texturen wie jener, die Sie ansprechen, kann man einzelne Simmen orchestral heraushören. Schubert dachte beim Schreiben wenig vom Klavier, eher vom Orchester oder von größer besetzter Kammermusik her. Man muss bei ihm ständig Bass-Pizzikati oder Bläserlinien imitieren. Den Anfang der H-Dur-Sonate, den ich gerade am Wickel hatte, empfinde ich als einen Ouvertüren-Beginn mit Oboensolo. Das hat gar nichts mit einer Klaviertextur zu tun und muss dementsprechend auch anders gespielt werden. Das geht auf diesem Instrument ganz hervorragend. Überraschenderweise tut dieser Flügel plötzlich Dinge, die mich auf Gedanken bringen, auf die ich ohne ihn gar nicht gekommen wäre. Er inspiriert mich.

Der erste Satz der D-Dur-Sonate D 850 sieht aus wie der Klavierauszug einer Symphonie. Die Schwierigkeit hier besteht sicher darin, einen leichten, transparenten Klang zu erzeugen bei einem sehr dicken Satz.
Ja, genau! Es darf nicht überwältigend-massiv werden, sondern muss prächtig-massiv bleiben. Es darf nichts Dickes, Schweres, Elefantöses bekommen. Auch hier kommt einem der Vorzug des Instruments entgegen, die Attacke zuzulassen, ohne dass es vom Volumen her zu viel wird. Ich bin sehr gespannt auf die tatsächlich unvollendete C-Dur-Sonate, die Reliquie, bei der das Unpianistische der Faktur ins Absurde gesteigert ist. Paul Badura-Skoda, den ich sehr bewundere, hatte überzeugend dargelegt, dass es sich hierbei nicht um Klaviermusik handeln kann. Da ist es besonders reizvoll, es trotzdem zu versuchen, weil das Klavier da, wo es das Klavier übersteigt, die Phantasie anregt. Bei Mussorgskis „Bildern einer Ausstellung“ ist es ja auch so, dass sie ihren ganzen Assoziationsreichtum eher in der Klavier- als in der Orchesterfassung freisetzen. Sind Sie eigentlich sicher, dass die frühe E-Dur-Sonate unvollendet ist? Die funktioniert doch sehr gut.
Eigentlich funktioniert sie sehr gut. Das Scherzo oder Menuett am Ende könnte in Haydns Sinn als Finale stehen.
Eben! Das gibt’s bei Haydn so oft.
Nur steht der Satz leider in H-Dur und nicht in E-Dur. Das spricht dagegen.
Aber das gibt’s bei Schubert öfter. Die As-Dur-Sonate, bei der man weniger Gründe hat, sie für unvollendet zu halten, endet in Es-Dur. So kurios das sein mag – passiert halt durchaus manchmal. Und das Menuett der E-Dur-Sonate hat einen Kehraus-Charakter.
Es wirkt fast wie ein Rondo.
Genau. Es könnte ein Rondo sein. Dramaturgisch funktioniert es wie ein Finale. Ich vermisse danach nichts mehr. Ich tendiere dazu, dass Schubert das als Schlusswort gemeint hat.
Sie haben viel über historische Flügel gesprochen. Haben Sie denn auch spielerische Erfahrungen auf ihnen gemacht?
Ich spiele zunehmend auf historischen Instrumenten. Die Partiten von Johann Sebastian Bach habe ich auf einem historisch nicht ganz korrekten, weil verspäteten Tangentenflügel aus der Zeit um 1790 aufgenommen. Auch Schumann und Brahms habe ich auf einem Flügel von 1860 in Arbeit. Ich taste mich durch die Tastengeschichte. Ich habe mich noch nicht getraut, die Wiener Klassik und Schubert auf Originalinstrumenten im Konzert zu spielen. Ausprobiert habe ich es schon: für mich selbst – aber vor Publikum oder im Studio noch nicht. Dazu brauche ich noch Zeit.

 vor 1 Tag
4
vor 1 Tag
4






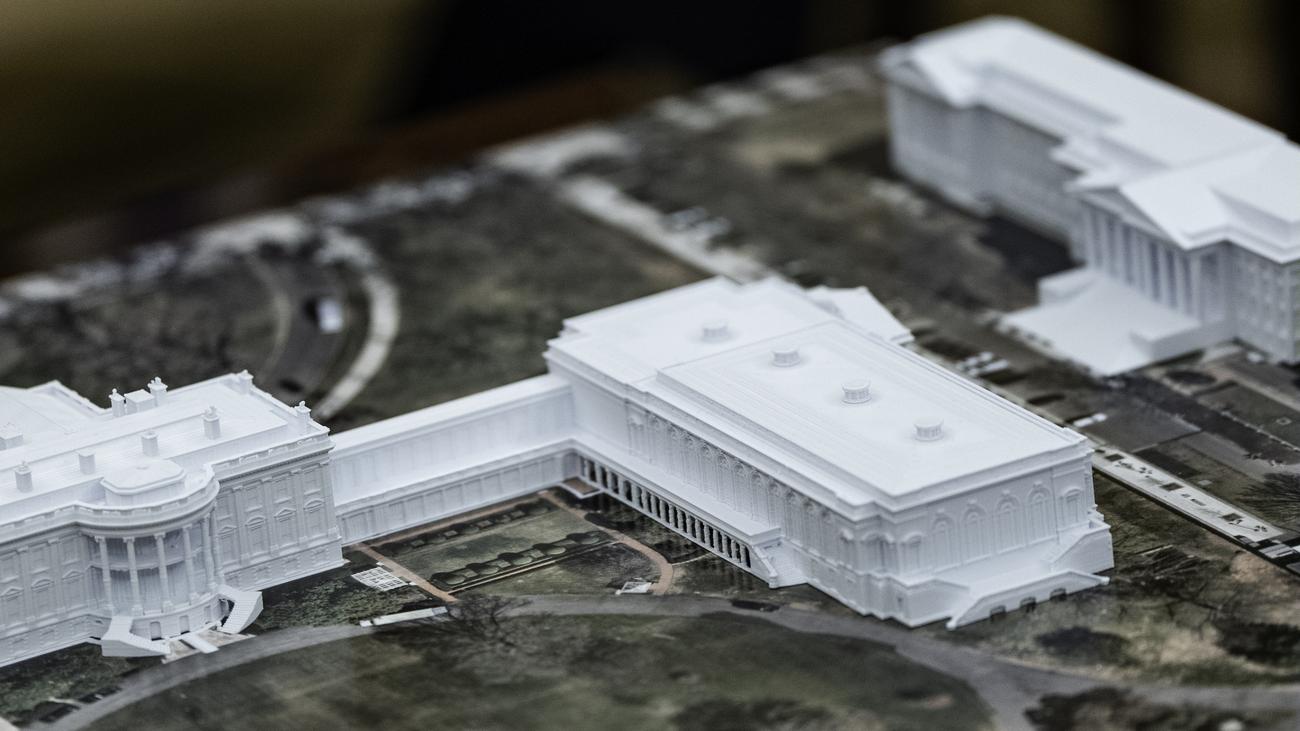



 English (US) ·
English (US) ·