Ein Meisterwerk der expressiven Moderne wird wiederentdeckt: Alban Bergs Oper „Wozzeck“. Sie war 1925 ein Riesenerfolg, wurde bald auf der ganzen Welt gespielt. Unter den Nazis war sie als „entartet“ verboten. In der Nachkriegszeit wurde sie wieder viel gespielt, mit einem Höhepunkt in den Neunzigerjahren, danach hörte man sie seltener. Nun kommt das Werk wieder auf die Bühne der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Büchners Stück heißt „Woyzeck“, die Oper „Wozzeck“. Die unterschiedliche Schreibweise ist gewollt. Sie beruhte zwar ursprünglich auf einem Fehler, Berg besaß eine Ausgabe, deren Herausgeber sich in der Kurrentschrift, der alten deutschen Schreibschrift, verlesen hatte, dort sehen y und z sich ähnlich. Als Berg darauf hingewiesen wurde, beließ er es trotzdem bei den zwei z. Er wollte damit klarmachen, dass die Oper ein eigenständiges Kunstwerk ist. Und er wollte den härteren, kantigen Klang des Namens.
Die Inszenierung von Andrea Breth war erstmals 2011 zu sehen, damals aber nur auf der Ausweichbühne des Schillertheaters, weil das Opernhaus sieben Jahre lang renoviert wurde. 2020 stand Breths Version noch einmal auf dem Programm, musste aber wegen der Corona-Maßnahmen ausfallen. Nun wird die Inszenierung zum Jubiläum erstmals dort aufgeführt, wo sie immer hin sollte: auf der Bühne des Opernhauses in Berlin-Mitte.
Georg Büchners Drama „Woyzeck“ erzählt von einem einfachen Soldaten, der unter psychischem und sozialem Druck zusammenbricht. Was ist das Besondere an Alban Bergs „Wozzeck“-Adaption für die Oper?
Sie ist ein tolles, umwerfendes Stück Musik. Und sie ist die beste Version dieses Stoffes. Man wird als Theaterregisseur sehr häufig gefragt, ob man Büchners „Woyzeck“ als Schauspiel machen will. Mir kam es aber immer vor, als wenn der Text gar nicht recht funktioniert. Er ist ein Fragment, und die meisten Versuche, es umzusetzen, erschienen mir als wenig schlüssig. Mit dieser Oper ist es anders! Nur bei Alban Berg funktioniert dieser schwierige Stoff.
In seiner Musik entsteht oft eine punktgenaue Schrillheit. Das passt zu der Welt Wozzecks, einer gnadenlosen Welt, durch die der arme Soldat getrieben wird. Unter Misshandlungen schlimmster Art muss er sein Geld verdienen, um die Familie zu ernähren. Es reicht nie. Er wird kriminalisiert, ihm bleibt nichts anderes übrig. Das hat mich in der geballten Version von Berg fasziniert. Der damalige Generalmusikdirektor der Staatsoper, Daniel Barenboim, hat mir einen Wunsch freigestellt, nachdem wir Tschaikowskys „Eugen Onegin“ gemacht haben in Salzburg. Ich wünschte mir den „Wozzeck“.
Die Oper beginnt damit, dass Wozzeck sich selbst maßregelt: „Langsam, Wozzeck, langsam!“, heißt es da in einem Monolog. Er ist ein Getriebener von der ersten Sekunde an. Passt das auch gerade zur Welt heute?
Man findet den Bezug zur heutigen Welt, weil dieses Kunstwerk so gut ist. Gute Kunst ist immer welthaltig und lässt mehrere Lesarten zu. Außerdem ist das Große an dem Werk, dass es eben nicht tagespolitisch ist. Es ist eine Metapher der Armut. Die gibt es zunehmend auch heute, darüber wird in Deutschland erschreckend wenig gesprochen. Wir haben Kinder in Armut, deren Zukunft völlig unklar bleibt. Armut nimmt den Menschen viel. Und dem Wozzeck widerfährt eine regelrechte Entindividualisierung, er wird zur Kreatur heruntergezogen, zum Experiment gemacht, wenn der Arzt Dinge an ihm ausprobiert. Hier findet ein Mensch keinen Halt mehr. Ich schätze es aber nicht, wenn das Theater dem Zuschauer etwas aufs Auge drückt, was er auch in der Welt draußen sieht, denn er versteht die Dinge dadurch auch nicht besser. Wir haben mit dem Bühnenbildner Martin Zehetgruber eine Drehbühne erschaffen, die wie ein ewiges Holzgefängnis aussieht. Die Räume sind winzig, getrennt durch Holzgitter, man kann immer alles sehen, es gibt kein privates Dasein. Und es dreht sich, weil Wozzeck immer gehetzt ist, er rennt und rennt, wie ein Hamster im Rad. Es wird nie besser, es wird immer schlimmer: Er taumelt von einer Arbeit zur nächsten und wird doch immer wieder versklavt. Alban Berg hat in der Oper wunderbare Zwischenspiele komponiert, die die Szenen voneinander trennen, und da wird es bei mir einfach schwarz. Da will ich nichts bebildert haben. So bleibt die blitzlichtartige, gruselige Kurzform der Oper erhalten: von einer Katastrophe in die nächste.
Wozzeck ist Opfer und Täter zugleich. Seine Frau Marie steht ihm aber auch nicht zur Seite, sie verfällt einem anderen, der Stärke ausstrahlt. Dazu ist oft gesagt worden, sie sei eine kalte Frau. Wie sehen Sie das?
Es ist leicht ist zu sagen, dass die Marie ein Unwesen ist, dass sie schrecklich handelt. Zu leicht. Mir ist das zu einfach. Sie sieht ihren Mann so gut wie nie. Er muss in der Kaserne leben. Das bisschen Geld, was er hat, liefert er ab für das gemeinsame Kind. Doch diese Frau will auch leben. Sie hat auch Sehnsüchte. So gerät sie in die Welt des Tambourmajors und wird missbraucht. Es ist entsetzlich, wie das alles aufeinanderprallt, wie eins zum anderen führt, bis zum Mord, Wozzeck bringt seine Frau um, dann sich selbst. Da ist niemand schuld. Ich finde nicht, dass man Verurteilungen aussprechen sollte von der Regie her. Das kann jeder sehen, wie er will, noch ist das Publikum mündig.
Sie sind als Theaterregisseurin bekannt geworden, waren zwanzig Jahre an der Wiener Burg, zuletzt haben Sie viel Musiktheater inszeniert. Darunter beide Opern von Berg, auch die „Lulu“. Was reizt Sie an diesem Komponisten?
Ich muss ehrlich sagen, nur „Wozzeck“ reizt mich. „Lulu“ war ein Wunsch von Daniel Barenboim, „Lulu“ ist überhaupt nicht meine Sache. Ich habe während dieser Arbeit extrem gelitten, ich mag’s weder von Wedekind noch von Berg, ich mag’s einfach nicht, dieses Stück. Fragen Sie mich bitte nicht, warum. Beim „Wozzeck“ ist alles absolut faszinierend, es stimmt jedes Komma. Die Musik ist genial, und der Dirigent muss aufpassen, dass er den Text nicht übertönt, denn der gehört gleichwertig dazu.
 Die Regisseurin Andrea BrethBrauer
Die Regisseurin Andrea BrethBrauerIhre Regiearbeiten gelten als kompromisslos und antiromantisch, manchmal schwer verdaulich, und doch gab es damals für diese Inszenierung viel Lob. Haben Sie sich gefreut?
Ich hab das gar nicht so mitbekommen. Gefreut hat mich nur, dass es einige Zeit auf dem Spielplan blieb. Jetzt bin ich ein bisschen nervös, weil alles umbesetzt wurde und ich gar nicht dabei bin, ich arbeite gerade in Wien an einem Stück über Goebbels’ Sekretärin Brunhilde Pomsel. Ich finde es zum Beispiel wichtig, dass Wozzeck ein ganz dünner Sänger ist, solche Äußerlichkeiten spielen eine Rolle. Er darf nicht wohlgenährt sein, das wäre inhaltlich falsch. Es darf auch nicht nur um schöne Stimmen gehen, sondern eher um einen schrillen Ton, fast am Rande des Schreis. Wozzeck ist am Ende seiner Kraft, halb tot, ausgezehrt, er isst nur noch Erbsen. Das muss man hören.
Sie hatten in den Neunzigerjahren lange eine psychische Erkrankung, haben deswegen Stücke abgesagt. Heute wird viel offener über solche Probleme geredet, hätten Sie sich das damals auch gewünscht?
Ich habe es ja getan, ich habe immer offen darüber gesprochen. Und zwar weil ich sah, dass Menschen in den sogenannten bürgerlichen Berufen panische Angst davor hatten, dass man rauskriegt, woran sie leiden. Viele in dieser Gesellschaft halten seelische Leiden nach wie vor für keine echte Krankheit. Eine Grippe können die Menschen nachvollziehen, eine Depression aber nicht. Gleichzeitig leiden sehr viele an schweren psychischen Krankheiten. Wir sollten mehr darüber sprechen, wie viele Menschen in Deutschland psychische Störungen haben, auch schon Kinder. Was läuft denn da falsch in dieser Gesellschaft?
Ist das nicht auch das Thema des „Wozzeck“? Dieser unheimliche Zwang, der auf den Menschen lastet?
Die Oper tut uns jedenfalls heute noch weh, weil sie an Wunden rührt, die es noch gibt. Oder, wie mein Patensohn sagt: Es ist kein Schenkelklopfer. Die Aufführung ist beklemmend und muss es auch sein.
Hätten Sie Lust, noch mehr Oper zu machen?
Ich mache schon längst mehr Oper als Schauspiel. Ich habe im Sommer mit Riesenerfolg die „Pénélope“ von Gabriel Fauré an der Bayerischen Staatsoper inszeniert, davor in Aix-en-Provence Puccinis „Madame Butterfly“. Nächstes Jahr mache ich in Frankfurt Puccinis „Turandot“. Ich werde mehr und mehr für Oper gefragt. Ich weiß nicht mehr, wie ich das alles hinkriegen soll. So sieht es aus.

 vor 1 Tag
4
vor 1 Tag
4






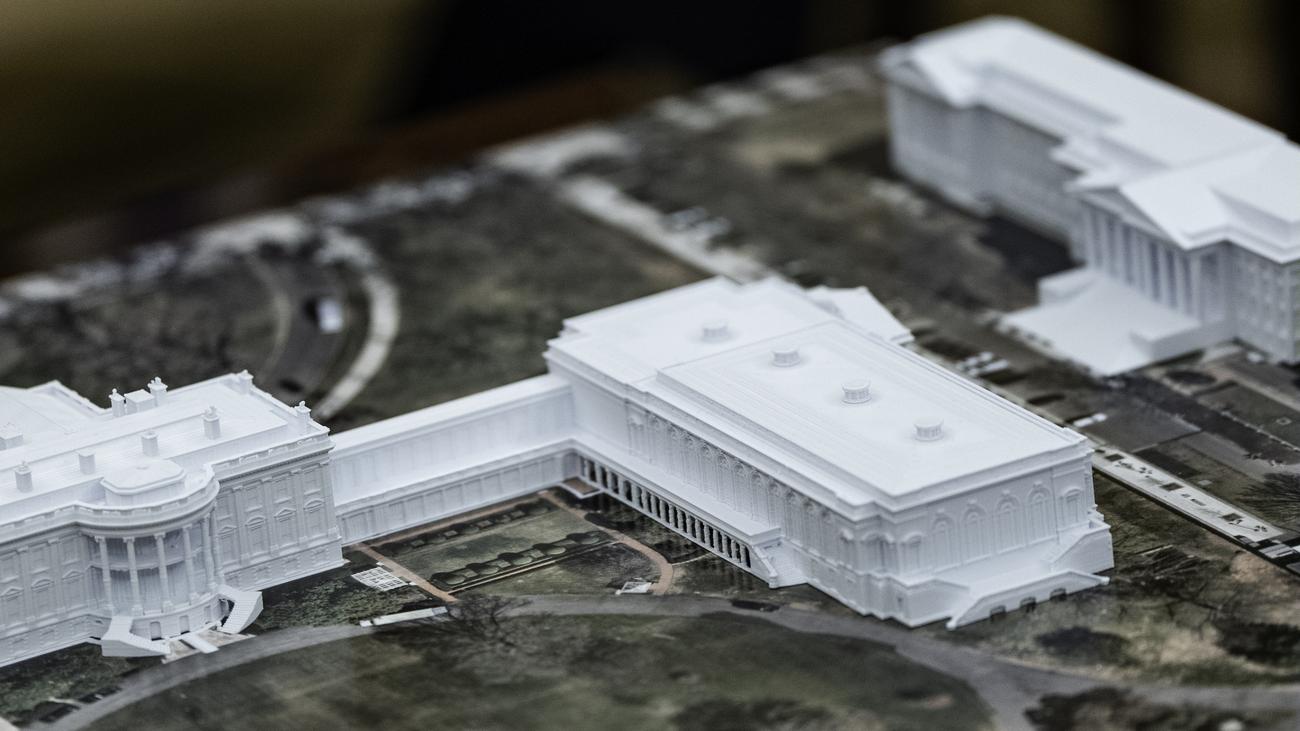



 English (US) ·
English (US) ·