Wie sie den alten Mann in seinem Haus am Rand des abgelegenen Dorfes gefunden haben, ist nicht wichtig. Auch über die ärmliche Ausstattung der Behausung lässt sich hinwegsehen, zumal der Bewohner sein Bestes gibt, die Besucher zu versorgen und schnell gebrühten Kaffee herumgehen lässt, später auch billigen Wein aus dem Kanister. Entscheidend ist etwas anderes: Dürfen die Besucher den Mann mit „Majestät“ anreden? Nein, wehrt er huldreich ab, fürs Erste bitte nur „Onkel Jozsi“. Aber später, wenn er in seine Geburtsrechte eingesetzt und als ungarischer König in der Burg auf den Budaer Bergen residieren werde, dann werde er auf die Anrede „Majestät“ bestehen.
Immerhin teilt er seine Familiengeschichte schon jetzt mit den Anhängern: Er ist ein Nachkomme des ungarischen Königs Bela IV. aus dem Geschlecht der Arpaden, allerdings ist diese Nachkommenschaft in Vergessenheit geraten, weil auch die – im späten dreizehnten Jahrhundert geschlossene – Ehe zwischen Belas Tochter Jolenta Helena und dem Mongolenfürsten Kadan geheim gehalten wurde. Der Fürst, ein Enkel Dschingis Khans, habe zur Tarnung den letzten Buchstaben seines Namens abgelegt und den neuen dann vererbt: Bis heute, der Roman spielt zwischen 2012 und 2014, heißt Onkel Jozsis Familie Kada.
In ihrer Wahnwelt befangen
Die Anhänger – Handwerker, Lehrer, ein Gutsbesitzer, Polizisten, ein Amateurhistoriker – vernehmen es mit Staunen und Zustimmung. All das passt zu ihrem Wissensstand um diese Erbfolge, aber die Details, die sie an den vielen Tagen in Jozsis Gesellschaft zu hören bekommen, sind einfach zu schön. Natürlich auch seine Erlebnisse mit schönen und prominenten Frauen, seine Jugendtage mit dem späteren Tarzan-Darsteller Johnny Weismueller, der seine Muskeln Jozsis Training verdankt, schließlich die Anerkennung als letzter Spross der Arpaden 1944 durch den ungarischen „Reichsverweser“ Horthy – die materiellen Beweise hüte er in verborgenen Winkeln dieses Hauses, sagt er. Dass er sie vorzeige, fordern seine Anhänger nie.
 László Krasznahorkai: „Zsömle ist weg“.S. Fischer
László Krasznahorkai: „Zsömle ist weg“.S. FischerAber sie haben einen anderen Wunsch an ihn, und spätestens hier wird deutlich, vor welchem politischen Hintergrund der diesjährige Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai seinen neuesten Roman angesiedelt hat: Sie hadern mit der gegenwärtigen Verfasstheit Ungarns, mit dem, wie sie meinen, „historischen Chaos, dieser globalisierten Zerstörung, die das gute Empfinden eines jeden Ungarn verletzt und zugrunde richtet“. Kurz: Sie sind für die Wiedererrichtung der ungarischen Monarchie. Dafür kommt natürlich kein Habsburger infrage, keine neue Fremdherrschaft. Mit einem Nachkommen von König Arpad und zugleich von Dschingis Khan wäre das etwas anderes.
Wer ein solches Szenario entwirft, bewegt sich zwischen zwei Klippen: Zeichnet er seine in ihrer Wahnwelt befangenen Protagonisten allzu verständnisvoll, weckt er womöglich Sympathie für ihr gefährliches Anliegen. Legt er ihren Wahn übertrieben offen, bestätigt er das Vorwissen und die Überzeugungen der Leser in einem Maße, dass die Lektüre irgendwann wenig attraktiv wird. Dieser Roman nimmt vor allem die Perspektive des einundneunzigjährigen Thronprätendenten ein, der sich im Recht sieht, aber gerade deshalb alles Unrecht schroff ablehnt, mit dem ihm dazu verholfen werden soll. Als seine Anhänger ihm stolz ein geheimes Waffenlager zeigen, das sie für einen Umsturz zusammengetragen haben, weist er sie zurück und will sie nicht mehr sehen. Später lässt er sich nur noch von denjenigen besuchen, die mit Gewalt nichts zu tun haben, etwa dem Musiker, dem der Autor seinen eigenen Namen verliehen hat. Ihn schätzt Onkel Jozsi, weil er mit ihm gemeinsam die alten ungarischen Lieder singen kann.
Natürlich erinnert das an ähnliche Umtriebe in Deutschland, und der selbst ernannte Thronfolger will auch mit „dem Heinrich XIII. Prinz Reuß“ befreundet sein, „ich spreche perfekt Deutsch, wir verstehen uns also in jeder Hinsicht gut, er will das Gleiche wie ich, doch seine Mittel sind andere“. Auch die Faszination, die von Insignien der Königsmacht ausgeht wie hier der historischen Stephanskrone, erscheint nicht unvertraut. Und die Rhetorik seiner Anhänger trifft sich bisweilen sogar mit den nationalistischen Verlautbarungen der jetzigen ungarischen Regierung. Allerdings ist es der Staat, der mit Härte und teils langjährigen Gefängnisstrafen dem Spuk ein Ende macht – nur der offensichtlich verwirrte Onkel Jozsi kommt nicht in Haft, sondern landet in der Psychiatrie, nachdem er die Richterin angedroht hatte, sie hinrichten zu lassen, wenn er erst seinen rechtmäßigen Platz im Land eingenommen hätte.
Mit seiner Erzählweise, die auf abgeschlossene Sätze gern verzichtet, mit seiner freundlichen Ironie und seinem Interesse für den Moment, in dem ein Wahn auf den anderen trifft, fügt sich „Zsömle ist weg“ gut ins Gesamtwerk des diesjährigen Literaturnobelpreisträgers ein, der sich die Auszeichnung morgen in Stockholm abholt. Es fehlt auch nicht an Anspielungen auf frühere Bücher. Deutlicher aber als dort konfrontiert er den Protagonisten diesmal mit dem Blick seiner Umgebung auf ihn selbst, und das umso intensiver, je weiter das Buch voranschreitet. Besonders die Presseberichte seines Gerichtsverfahrens leuchten grell aus, welchen Eindruck der Angeklagte hinsichtlich seines Geisteszustands macht, wobei die große Kopfnarbe aus Kriegszeiten eine gewichtige Rolle spielt. Prägnanter und besorgter der resignierte Seufzer seiner Tochter, als es zu einer der raren Begegnungen der beiden kommt: „Willst du wieder eine Sekte gründen?“
Nein, will er nicht, das ist ja das Irritierende. Er will erzählen, von den Filmstars von ehedem, von dem herbeiphantasierten Ungarn früherer Tage, von „Dschimmi Karter“, von seinen mächtigen Freunden im Vatikan, und warnen vor „geklontem“ Wasser will er auch. Er will respektiert werden als Zentrum seiner Welt, zu der er gern Zutritt gewährt, solange man ihren Gründungsmythos nicht infrage stellt. Dass er damit zur Projektionsfläche antidemokratischer Umtriebe wird, kalkuliert er nicht ein, aber zum Werkzeug machen lässt sich der Greis nicht, der so viel weniger hinfällig ist, als seine Umgebung denkt.
„Halte dich fest“ sind die letzten Worte des Romans, gerichtet an den Hund Zsömle. Welch schillernde Ambivalenz sie in der Welt besitzen, unserer und der von Onkel Jozsi, steht auf den dreihundert Seiten zuvor.
László Krasznahorkai: „Zsömle ist weg“. Roman. Aus dem Ungarischen von Heike Flemming. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2025. 304 S., geb., 25,– €.

 vor 2 Tage
5
vor 2 Tage
5



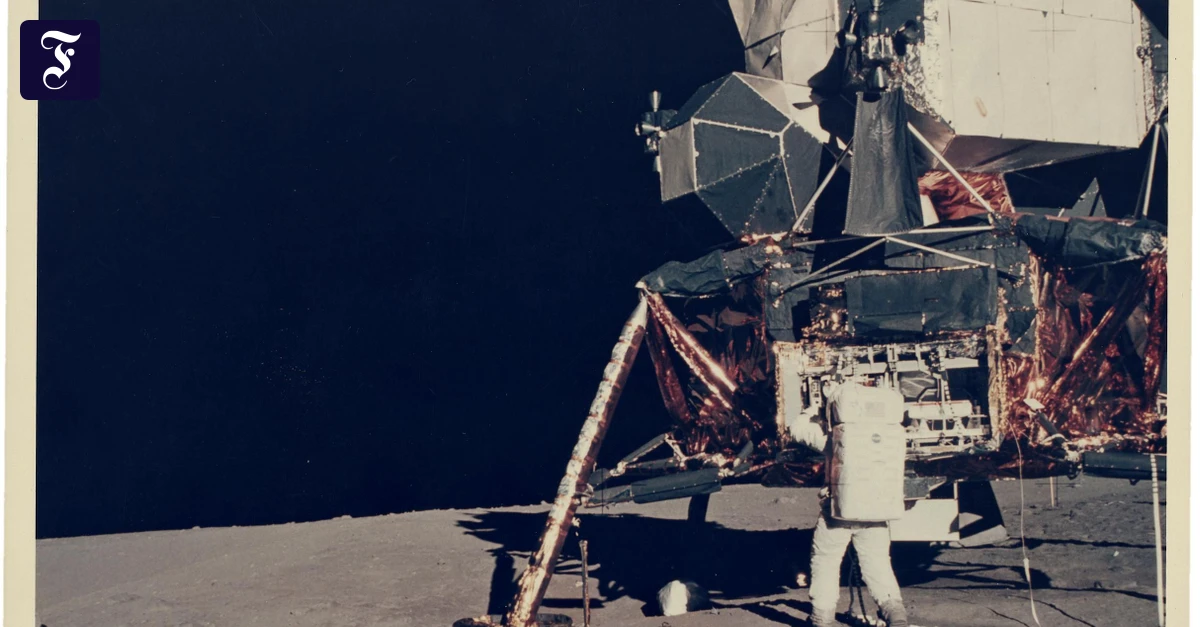





 English (US) ·
English (US) ·