Die Bibel? 1926? Hatte man, zwischen zwei Kriegen, nicht andere Sorgen? Und doch, ausgerechnet eine neue Bibelübersetzung provoziert einen leidenschaftlichen Streit, in dem es mit einem Schlag ums Ganze geht: Tief in den technischen Fragen der Übersetzungskunst explodiert die ganze höchst tagesaktuelle Krise von Judentum und Marxismus, Philosophie und Geschichte, Theologie und Politik. Und die heftigst polemisierenden Diskutanten, in tonangebenden Zeitungen wie in pausenlos kursierenden Briefwechseln, sind nicht etwa akademische Spezialisten, sondern einige der großen Intellektuellen der Weimarer Republik, darunter Siegfried Kracauer und Walter Benjamin, Margarete Susman und Gershom Scholem, Rudolf Borchardt und Ernst Bloch.
So liest sich diese äußerst verdienstvolle „Geschichte eines Projekts“ als überscharfe, atemberaubende Momentaufnahme aus einem Gemenge von Katastrophenbewusstsein, von inner- und außerweltlichen, politischen und religiösen Revolutions- oder Erlösungshoffnungen und Utopien.
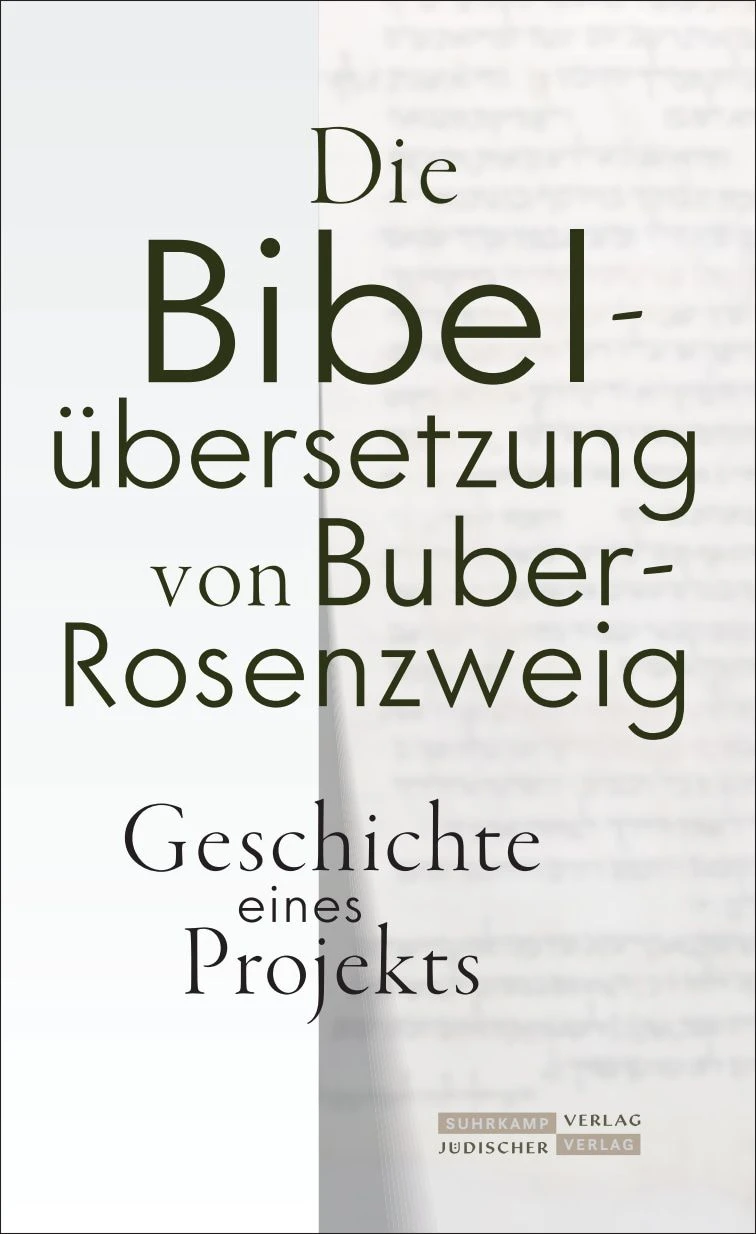 Hrsgg. von Ch. Kasten, A. Martins und I. Sauter: „Die Bibelübersetzung von Buber-Rosenzweig“. Geschichte eines Projekts.Jüdischer Verlag
Hrsgg. von Ch. Kasten, A. Martins und I. Sauter: „Die Bibelübersetzung von Buber-Rosenzweig“. Geschichte eines Projekts.Jüdischer VerlagAnfang 1926 erscheint nach irritierend kurzer Arbeitszeit der erste Band von „Die Schrift. Zu verdeutschen unternommen von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig“; dabei ist „Das Buch Im Anfang“ das, was in christlicher Tradition Genesis oder 1. Buch Mose heißt, und schon die Titelwahl ist Programm. Martin Buber ist seit Jahren prominente Figur des deutschen Judentums, Franz Rosenzweig zwar weniger bekannt, als Verfasser des bedeutenden Buchs „Der Stern der Erlösung“ jedoch von philosophischem Gewicht. Der erste Plan einer „revidierten Lutherbibel“ erweist sich schnell als unausführbar, viel zu tief eingesenkt in den deutschen Wortlaut sind christliche Theologie, Bilder, Begriffe, Namen, und so fällt die Entscheidung für ein viel radikaleres Projekt: die vollständige Neuübersetzung in aktuellem jüdischen Geist. Fertig wird das epochale Werk erst 1938, fast ein Jahrzehnt nach Rosenzweigs Tod.
Die Reaktion ist aggressiv
Die sofort einsetzenden Reaktionen zeigen, aufgenommen wird „Das Buch Im Anfang“ keineswegs als antiquarische Philologie, vielmehr als Aussage zur Stunde: Die Bibel ist eben kein „Klassiker in Neuübersetzung“, sondern erhebt als Wort Gottes einen Wahrheitsanspruch, an dem auch jedes Aktualisierungsinteresse sich messen muss – allein ästhetische Kriterien sind hier ausgeschlossen, für den Übersetzer wie für den Kritiker. Zwischen all den im vorliegenden Band abgedruckten Dokumenten schält sich eine zentrale Kontroverse heraus: Ende April 1926 publiziert Siegfried Kracauer in der Frankfurter Zeitung „Die Bibel auf Deutsch“, und seine umfangreiche Rezension konzentriert sich sogleich auf die Frage nach der Bedeutung der Bibel für die Selbstreflexion der gesellschaftlichen Gegenwart und nach dem Sinn, den eine solche Übersetzung darin annehmen kann.
Das Urteil ist negativ. Der Kritiker bestätigt vorab, die Übersetzer hätten „sachkundig und gewissenhaft“ gearbeitet. Ihre Kompetenz im Hebräischen stellt er nicht infrage; seine Ablehnung richtet sich, ausgehend allein von der „deutschen Sprachform“, gegen den aktuellen Anspruch im Sinne einer „religiösen Erneuerung“. Dahinter zeigt sich natürlich Kracauers höchsteigene Variante einer materialistisch-marxistischen Gegenwartsdiagnose, die konsequent vor der Tür von Religion und Metaphysik ausharrt: „Denn der Zugang zur Wahrheit ist jetzt im Profanen.“
 Martin Buber (1878 bis 1965)Foto Picture Alliance
Martin Buber (1878 bis 1965)Foto Picture AllianceDas Scheitern eines unmittelbaren Zugriffs auf ursprüngliche religiöse Gehalte erkennt er konkret im Deutsch dieser Übersetzung, das sich hebräischen Strukturen unterwerfe, zugleich infiziert sei von zeitgemäß-pompösen Manierismen à la Richard Wagner oder Stefan George. Was Erneuerung religiöser Substanz sein soll, erleide den „schnellen Substanzverlust jeder Sprache, die gegenwärtig sakral und esoterisch sich gebärdet“.
Die Reaktion ist extrem aggressiv: Buber und Rosenzweig beschließen, den Tenor von Kracauers Kritik schlechterdings zu ignorieren, antworten in ihrer Replik philologisch auf gar nicht erhobene Vorwürfe. Dabei verblüfft besonders ein fast schon naiver Begriff übersetzerischer „Wörtlichkeit“. Auf Kracauers Kritik an wagnerschen Alliterationen antworten sie: „Luthers ‚Wolken führen‘ heißt hebräisch: ‚annen anan‘, infolgedessen bei uns: Wolken wölken.“ Das Hebräische also kennt ein Verb mit dem gleichen Wortstamm wie das Substantiv, das Deutsche nicht – ist aber eine Übersetzung „wörtlich“, die das vermisste Verb einfach erfindet? Und eine kategorische Feststellung wie „‚fsewa‘ heißt Greisentum“ ist fast sinnlos, denn für den Übersetzer „heißt“ A niemals umstandslos B, und in diesem Falle je nach Kontext, historischem Sprachstand auch etwa Alter, hohes Alter, Greisenalter, Lebensabend.
Der Zorn der Kritisierten
Diese Verweigerung ist umso absurder, als es auf Kracauers These vom Substanzverlust religiöser Sprache doch durchaus etwas zu erwidern gab. Das tat vor allem die Religionsphilosophin Margarete Susman, die am deutlichsten Partei ergriff für ihre beiden Freunde. Deshalb sind die Auseinandersetzungen im Hintergrund viel interessanter als der allzu überhebliche Zorn der Kritisierten: Ernst Bloch begreift zum ersten Mal Kracauers materialistisches Misstrauen gegen religiöse Emphase, das ihn einige Jahre zuvor selbst hart getroffen hatte, und beginnt eine neue, bald wieder wacklige Freundschaft.
Benjamin applaudiert Kracauer bedingungslos, bittet ihn, „das gesamte Aktenmaterial des Falles an Dr. Scholem, meinen Freund“ zu schicken. Scholem schreibt aus dem fernen Jerusalem: „Kracauers Kritik kenne ich nicht. Meine eigene, 10 Zeilen lang, liegt im Schreibtisch.“ Das sprachtheologische Argument für diesen schweigenden Verriss findet sich bereits in Scholems Jugend-Tagebuch vom Winter 1917: „Das absolute Schriftwerk ist unübersetzbar, obwohl es reinste Sprache ist. Die Bibel übersetzen hieße, sie noch einmal schreiben. Dies verbietet sich.“
Was der vorliegende Sammelband packend nachvollzieht, ist der bis heute keineswegs antiquierte Streit um die Aktualisierbarkeit religiöser Gehalte, und sei’s in jenen politischen Utopien des 20. Jahrhunderts, die sich zwar atheistisch verstehen, jedoch die ganze Last religiöser Erlösungsmystik mit sich schleppen. Einzige Fehlanzeige ist der unvergessliche Briefwechsel zwischen Buber und Rudolf Borchardt.
Borchardt, der durch seinen „Dante deutsch“ einige Erfahrung hatte mit dem kunstvollen Salto rückwärts über historische Distanzen, argumentiert in manchem ähnlich wie Kracauer, verwirft also, bei erheblicher Hebräischkenntnis, „Die Schrift“ konsequent als Werk deutscher Sprache: „Ich wollte, verehrter Herr Buber, ich könnte in persönlicher Anwesenheit soviel Wärme und thätige Teilnahme in meine Worte legen, daß Sie es nicht als kränkend empfänden, wenn ich es nun so aufrichtig bekümmert wie ich muß, ausspreche, daß Ihre Übersetzung – als eine übertragende Schöpfung – weder schlecht ist noch gut ist – sie ist überhaupt nicht.“
Was Borchardts radikale, sachliche, überaus detaillierte Kritik von fast jeder anderen unterscheidet, ist der Ton tiefer Hochschätzung, der jede Polemik ausschließt. Vielleicht allerdings wurde gerade dadurch das Urteil noch schmerzhafter. Buber jedenfalls hat auch hier am Ende nicht mehr geantwortet.
Hrsgg. von Ch. Kasten, A. Martins und I. Sauter: „Die Bibelübersetzung von Buber-Rosenzweig“. Geschichte eines Projekts. Suhrkamp Verlag/Jüdischer Verlag, Berlin 2025. 475 S., geb., 38,– €.

 vor 2 Tage
7
vor 2 Tage
7



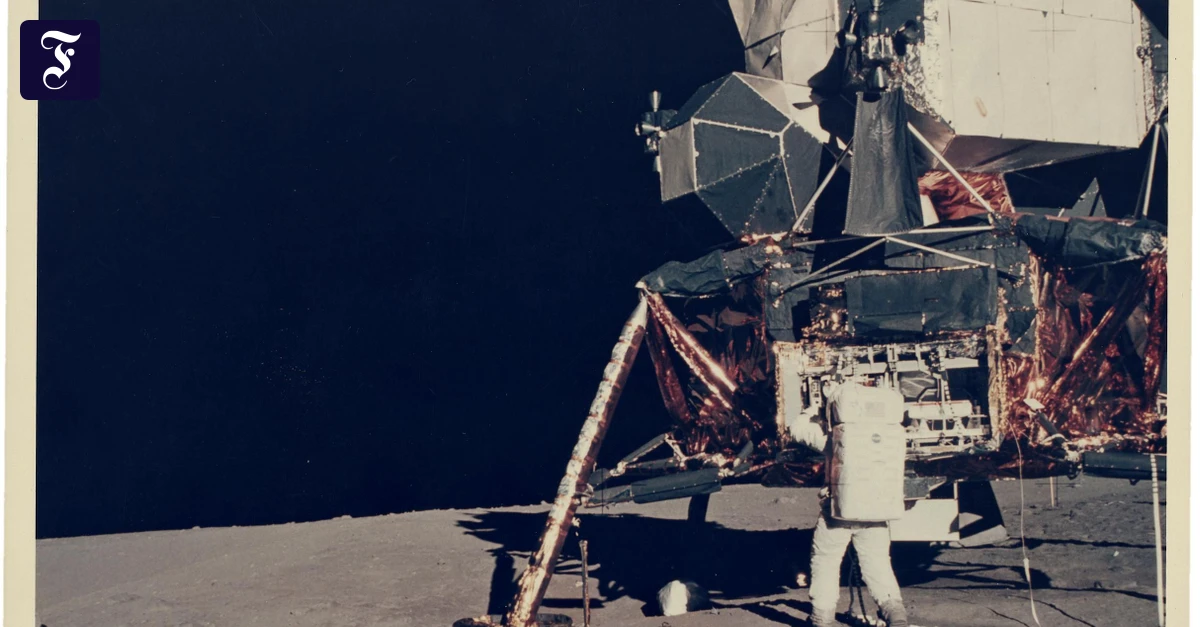





 English (US) ·
English (US) ·